
Diskussion mit (v.l.n.r.) Martin Drechsler, Nathanel Liminski, Carla Siepmann, Markus Beckedahl
(Foto: Jan Zappner – re:publica)
Die 17. re:publica #rp24 vom 27. bis 29. Mai 2024 in Berlin stand unter dem doppeldeutigen Motto „Who cares?“. Dabei ging es darum, wer sich um wen oder was in der digitalen Gesellschaft kümmert. Nach den Anfängen in der Kalkscheune und im Friedrichstadtpalast fand die re:publica zum ersten Mal seit 2019 wieder in der Station Lounge am Berliner Gleisdreieck statt. 2022 und 2023 war die „Konferenz zur digitalen Gesellschaft“ in der Arena Kreuzberg zu Gast. In den beiden Jahren zuvor fand die re:publica coronabedingt nur online statt.
Ein Grund für den neuerlichen Umzug ist das beständige Wachstum. Die Station Lounge nebst angrenzendem Gelände und Technikmuseum bot nun für 31 Bühnen-Situationen Platz, auf denen in den drei Tagen insgesamt 818 Sessions – Vorträge, Diskussionen, Workshops etc. – stattfanden. Diese hatte das Programmteam aus ebenfalls rekordverdächtigen über 1.500 Einreichungen in mehreren thematischen Tracks kuratiert. Dabei sind die Nähen einer Session zum Thema mal mehr, mal weniger offensichtlich. Wer sein aktuelles Buch vorstellen kann, hat offensichtlich gute Chancen, dabei zu sein, denn an etliche Sessions schlossen sich Signierstunden an.
Nacharbeit ist angesagt
Erfreulicherweise wurde das komplette Programm der Bühnen 1 bis 3 und 5 bis 10 und der Lightning Boxes aufgezeichnet und zeitnah bei YouTube veröffentlicht. Denn viele zogen angesichts des schlicht zu umfangreichen Angebots mit einer langen Watchlist nach Hause. Schließlich liegen wie bei jedem guten Barcamp die spannenden Sessions (gefühlt) häufig parallel. Deshalb heißt ein Tag #rp24 auch, sich immer wieder zwischen kollidierenden Sessions zu entscheiden. Und dann sind da ja auch noch die zahlreichen spontanen Begegnungen und Gespräche in diesem großen und vielfältigen Konferenz-Netzwerk.
#rp24: Who cares?
Passend zum diesjährigen Motto spielte soziale und pflegerische Care-Arbeit in zahlreichen Talks, Podien und Workshops eine Rolle. Insofern passte es gut, dass die Wohlfahrtsverbände erstmals mit einem gemeinsamen Stand im Foyer präsent waren. Und zwischen und über allem das Meta-Thema KI: in der Pflege, in der Bildung, im Umweltschutz, in der Unterhaltungsindustrie (Hollywood, Musik, Textschöpfung) … und was in der Debatte alles falsch läuft bzw. welche Narrative offensichtlich interessengeleitet sind und worüber wir ganz dringend nachdenken müssen. Denn der in der vergangenen Woche von der EU beschlossene AI Act muss in Deutschland erst noch in nationales Recht umgesetzt werden. Wie wichtige Bestimmungen der Verordnung ausgelegt und durchgesetzt werden, wird nämlich erst in den nächsten Jahren entschieden. Bei der Formulierung der entsprechenden Standards werden absehbar KI-Unternehmen beteiligt werden – die damit zumindest die Chance haben, sich ihre eigenen Regeln zu geben. Aktuell ist außerdem noch unklar, welche Behörde in Deutschland überhaupt für die Durchsetzung geltenden Rechts zuständig sein soll.

(Foto: Annette Riedl – re:publica)
Auch bei anderen Themen standen regulatorische Fragen ebenso wie notwendige politische Konsequenzen auf der Agenda. Egal, ob es um Jugendschutz, Datenschutz oder Hassrede und Fake News geht. Und in erfreulich vielen Fällen wurden die Diskussionen dazu durchaus kontrovers geführt. So diskutierten z.B. Alena Buyx und Ulrich Kelber über die Spannung zwischen Datennutzung und Datenschutz. Erster sollte möglichst umfassend zum Wohl der Menschen etwa in gesundheitlichen Krisen wie Corona sein. Andererseits bleibt gerade der notwendige Schutz persönlicher Daten ein Thema. Allerdings waren sich beide einig, dass an vielen Stellen insbesondere in Deutschland eine schlechte Datenschutz-Kultur herrscht, die bei mangelhafter Digitalisierung vorschnell die Waffen streckt, statt zu schauen, was unter Wahrung des Datenschutzes überhaupt möglich wäre.
Oder bei den zahlreichen Sessions rund um KI, Medienpädagogik und Bildung: Der differenzierte Blick und das kritische Argument führen immer wieder in Abwägungen, die keine einfachen Antworten zulassen. Wie kann zum Beispiel ein Jugendschutz gelingen, der funktioniert, aber so wenig wie möglich in Grundrechte eingreift? Wie können wir Hassrede und dem Rechtsruck auch in sozialen Netzen angemessen begegnen?
Ein Festival mit gesellschaftlicher Relevanz
Die vor neun Jahren ins Leben gerufene Tincon wurde in diesem Jahr mit insgesamt 4.000 jungen Besucher:innen erstmals komplett in die re:publica integriert. Mit Bühne 5 gab es auch einen gemeinsam bespielten Raum. Ansonsten waren Erwachsene als Gäste teilweise willkommen; zum Teil gab es auch Veranstaltungen, die exklusiv für Teilnehmende unter 25 Jahren reserviert waren.
Dass die re:publica gesellschaftlich relevante Themen verhandelt, zeigt zum einen die Zahl der anwesenden Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker:innen, die ihre Standpunkte darstellen konnten. Dabei zeigt sich immer wieder auch eine Grenze der Beteiligung der zahlreichen ehrenamtlichen Moderator:innen einschließlich der Mitgründer:innen der re:publica auf: Um Kommunikationsprofis wirklich zu stellen, braucht es professionelle Journalist:innen, die auch kritisch nachfragen (und nicht wie im Fall von Bundeskanzler Scholz auf der #rp22 vom zu Interviewenden gleich mitgebracht werden).
Zum anderen konnte re:publica Mitgründer Markus Beckedahl bei der mittlerweile traditionellen Abschluss-Session „Sold out“ verkünden. Denn mit insgesamt 30.000 Besucher:innen, einem neuen Rekord, waren die Kapazitätsgrenzen der Station Lounge erreicht. Insofern gilt den Planer:innen auch Lob für die Verteilung der Sessions. Erfreulich seltener als in früheren Jahren blieben die Türen einer Bühne wegen Überfüllung geschlossen.
Schließlich wird das Angebot nicht nur thematisch immer breiter: Neben einem Kids-Space gab es nun auch einen Baby-Space. Und Chill-out-Bereiche sowie ein paar Hängematten, um mal zwischendurch zur Ruhe kommen zu können. Der „Affenfelsen“ fiel diesmal etwas kleiner aus, aber auch so gab es genügend Nischen und Plätze zum Arbeiten, Reden und Innehalten. Das seit Jahren erkennbare Konzept der rp-Gründer:innen, aus der Konferenz für Blogger:innen und digitale Nerds ein Festival für die gesamte Gesellschaft zu machen, geht erkennbar auf.

(Foto: Jan Michalko – re:publica)
Religion im freien Fall?
Apropos gesamte Gesellschaft: Hinsichtlich der Relevanz der Kirchen macht die re:publica ebenfalls nachdenklich. Einreichungen von kirchlichen Akteur:innen waren offensichtlich keine berücksichtigt worden und nur eine Session beschäftigte sich mit Religion aus soziologischer Perspektive. Detlef Pollack, Münsteraner Religionssoziologie und Mitautor der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU), ordnete unter dem Titel „Religion im freien Fall?“ deren Ergebnisse aus dem letzten Jahr ein. Erstmals hatte sich auch die Deutsche Bischofskonferenz daran beteiligt. Während hierzulande Kirchenaustritte zahlreich und lautstark aufgrund enttäuschter Erwartungen bei katholischen oder eher lautlos bei evangelischen Kirchenmitgliedern stattfinden, haben die Kirchen in den skandinavischen Ländern einen besseren Stand, da sie als verlässliche Akteurinnen in Bildung sowie in sozialen Feldern wahrgenommen würden. Damit passte auch diese Session in das Rahmenthema – und zugleich gibt diese Analyse angesichts hiesiger Veränderungsprozesse zu denken. Die Zahl der kirchlichen Akteur:innen, die sich mittlerweile Jahr für Jahr auch zu einem ökumenischen Meetup am Rande der re:publica trifft, bleibt allerdings auch überschaubar.
#rp24 Who cares: Was bleibt und wie geht es weiter?
Das eine Fazit aus der #rp24 kann es angesichts der Breite der verhandelten Themen nicht geben. Zu detailliert ist das, was da in drei Tagen konzentriert verhandelt wird. Aber damit bildet die #rp24 die immer komplexeren Differenzierungen in einer modernen, von Digitalität geprägten Gesellschaft ab. An manchen Stellen mag hinter berechtigten Forderungen zu Veränderung und Entwicklung ein gewisser pragmatischer Fatalismus aufscheinen. So lautete in einer Session zum Einsatz von KI gegen Fakenews die Frage, ob der Kampf überhaupt zu gewinnen sei. Denn für Aufdeckung und Debunking gibt es nur ein kurzes Zeitfenster, bevor die Desinformation in den Köpfen der Menschen Raum gewinnt. Die Antwort: „Nichtstun ist auch keine so gute Idee“. Und das gilt zweifelsfrei auch in Bezug auf viele andere Themen, um die wir uns um der Zukunft unserer Gesellschaft willen kümmern müssen.
Nach der #rp24 ist vor der #rp25! Weiter geht’s aber erstmal vom 19. bis 21. September 2024, wenn die re:publica auf dem Reeperbahnfestival in Hamburg dabei ist. Ansonsten: auf Wiedersehen in Berlin zur #rp25 – der Termin wurde im Gegensatz zu früheren Jahren aber noch nicht verraten.
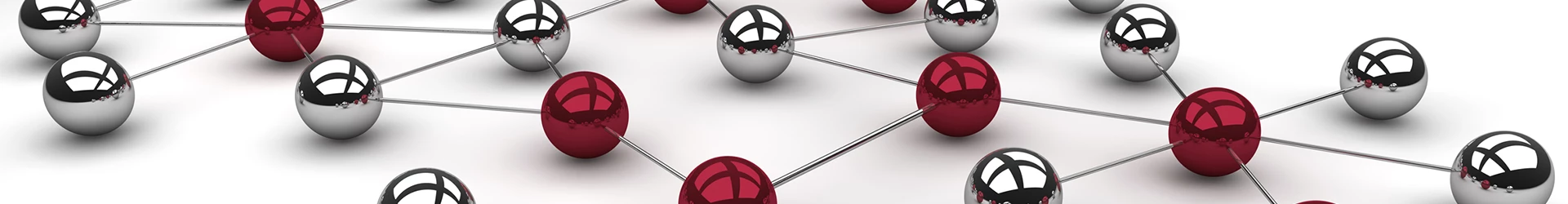
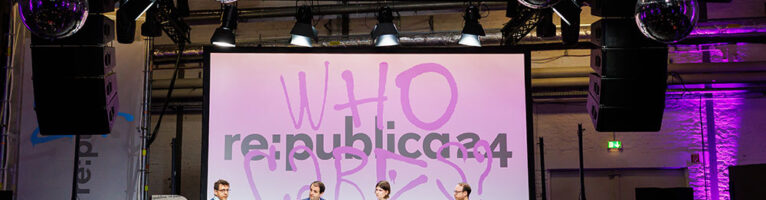
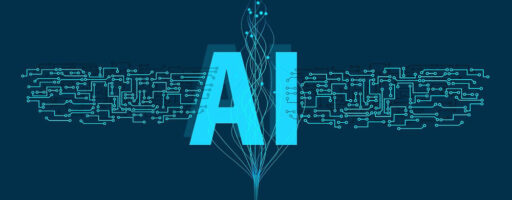


Pingback: Woran wir gerade arbeiten - Juli 2024 | Clearingstelle Medienkompetenz
Pingback: Woran wir gerade arbeiten - Juni 2024 | medienkompetenz.katholisch.de