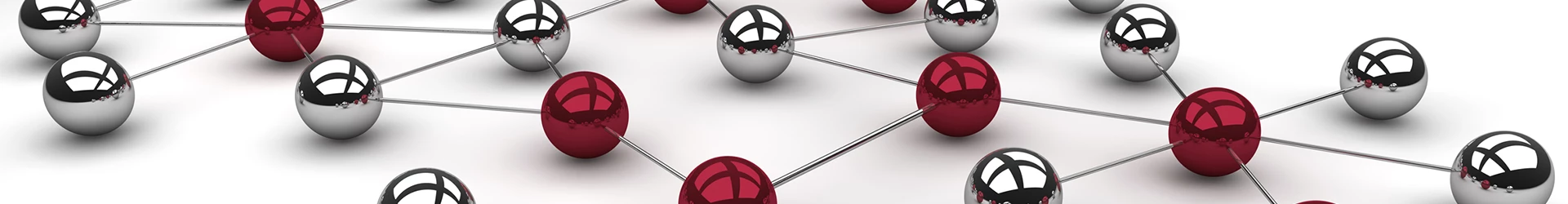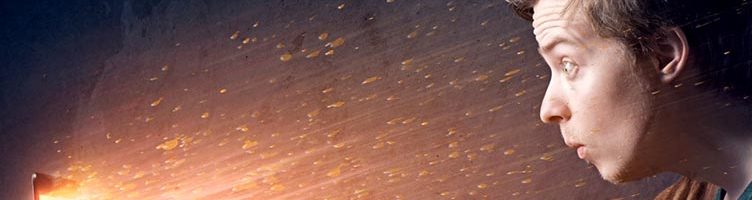In der Einführung umreißt er eher anekdotenhaft (S. 13-18) das Problem der „digitalen Demenz“, worunter er mehrere Auswirkungen der Nutzung digitaler Medien zusammenfasst, die letztlich alle zur „Verdummung“ führen.
Gegen seine Darstellung neuropsychologischer Prozesse (Kap. 1 und 2) ist nichts einzuwenden, zumal hier offensichtlich der Fachmann auf seinem Kerngebiet schreibt. Der Transfer auf digitale Medien und deren nahezu völlige Verdammung ist aber über weite Strecken völlig verunglückt.
Was ist daran zu kritisieren?
Im Kern sind es fünf Punkte, die das ganze Buch durchziehen und die Lektüre bisweilen zur Qual machen:
1. Der kulturpessimistische bis demagogische Stil – unter der Rettung der Welt im Namen der Kinder ist die Kritik nicht zu haben. Eine sinnvolle Integration digitaler Medien in unser Leben ist nach Spitzer eigentlich nicht vorstellbar. Dass heute andere Kulturtechniken und Lebensweisen im Sinne einer Differenz sinnvoll oder notwendig sein könnten, kann ebenso wenig sein. Mit dieser Defizitperspektive kommt er durchweg zu Überspitzungen und unhaltbaren Pauschalierungen, die eine sachliche Auseinandersetzung erschweren bis verunmöglichen: „Meiden Sie digitale Medien. Sie machen … tatsächlich dick, dumm, aggressiv, einsam, krank und unglücklich.“ (S. 325) Da ist es dann nur konsequent, digitale Medien mit Drogen auf eine Stufe zu stellen (S. 303f).
2. Der zweifelhafte bis unseriöse Umgang mit Studien wird in allen Debatten um Spitzers Publikationen thematisiert (vgl. u.a. http://www.zeit.de/2012/37/Jugendliche-Medienkonsum-Spitzer-Vorderer oder [Edit: Link entfernt, da defekt; 05.11.21]) – leider zu recht. Ein Beispiel zum Medienumgang Jugendlicher: Hier zitiert er nicht etwa die renommierte, mit jährlicher Erhebungswelle seit 1998 seriös durchgeführte JIM-Studie des MPFS, sondern eine einzelne Studie des in Fachkreisen aufgrund der seinerseits tendenziösen Arbeitsweise durchweg umstrittenen KFN (S. 12; vgl. auch S. 188). Damit sind dann wieder Pauschalierungen möglich, die eine „verlorene Generation junger Männer“ (S. 188) sieht – statt einer nach formalem Bildungsgrad, Milieus und anderen Kriterien durchaus vielschichtigen Problemlage.
3. Die Argumentationsweise von Spitzer ist an sich in mehrfacher Hinsicht fragwürdig: bisweilen baut er verbal potemkinsche Dörfer auf, die er dann lautstark einreißt. Aber wer hat denn bei klarem Verstand jemals gefordert, im Schulunterricht World of warcraft zu spielen (S. 187) oder würde ernsthaft die Ambivalenz Sozialer Netzwerke bestreiten (vgl. S. 127) – um nur zwei Beispiele zu nennen? Und dass kommerzielle Produkte entsprechender Unternehmen nicht per se pädagogisch wertvoll und nützlich sind, sollte eigentlich auch klar sein – aber dann könnte Spitzer sich ja nicht daran abarbeiten (S. 145).
Da hilft es auch nichts, dass er gelegentlich sattsam bekannte Wahrheiten nochmals durcharbeitet: digitale Medien wie eBooks sind entgegen manch politischem Getöse kein Wert an sich (S. 216ff) und Multitasking ist nach allen bislang vorliegenden Untersuchungen für Menschen unmöglich (S. 222-235). Aber das lehrt auch jedes Zeitmanagement-Buch der letzten 20 Jahre …
In diese Kategorie gehört auch die – häufig so genutzte, sachlich aber nicht gerechtfertigte – Einschränkung von „Medienkompetenz“ als Fähigkeit zum Umgang mit digitalen Medien (S. 310ff; dass Spitzer hier unkritisch das literacy-Konzept übernimmt, statt den Anschluss des Medienkompetenzbegriffs an Kompetenz- oder Bildungsdiskurse zu sehen, sei nur am Rande angemerkt. Vgl. dazu Grunert 2012)
4. Spitzer insinuiert Konsequenzen – ohne diese dann wirklich zu widerlegbaren Behauptungen zu formulieren. Dies ließe sich an einer Vielzahl einzelner Argumentationsketten belegen, die im Einzelnen zu bewerten sind und bei denen Leserinnen und Leser zu durchaus anderen Schlussfolgerungen kommen können als der Autor. Nur ein Beispiel: Das Abspeichern von Daten versteht Spitzer als Ablegen und setzt dies mit „als erledigt betrachten gleich“ (S. 103). Da erledigte Dinge uns nicht mehr so sehr beschäftigen wie unerledigte, „verhindern [wir] … dass unser Gehirn sich die Mühe macht, hier noch etwas abspeichern zu wollen und entsprechende Prozeduren durchzuführen“ (ebd.) Spitzer ergänzt diese Argumentation um die Beschreibung verschiedener psychologische Experimente zur Behaltensleistung und kommt dann dazu, dass Navigationsgeräte und Suchmaschinen uns suggerieren, dass wir uns nichts mehr merken müssen, da wir es bei Bedarf neu nachschauen können (S. 106). Dass dies ein – sinnvoller! – Anpassungsprozess sein könnte erwähnt er, ohne den Gedanken weiter zu verfolgen. Eine wirkliche (negative) Folgerung verweigert er aber auch – was wäre denn, wenn die Cloud nicht verfügbar ist? – und belässt es bei der Feststellung „Vielleicht bin ich einfach schon zu alt, aber ich male mir das nicht gerne aus!“ (S. 106) Wie aber sollen dem Leser solch „schwer absehbare Folgen … zu denken geben“? (S. 127)
5. Seine impliziten Verteidigungen (S. 18ff , 283ff, u.ö.) legen einen Zirkelschluss nahe, der das argumentative Gegenüber desavouiert: wer nicht Spitzers Meinung ist, äußert sich damit als bereits geschädigtes Opfer der von ihm bemängelten Auswirkungen oder hat die Gefahr eben immer noch nicht erkannt. In keinem Fall aber darf er oder sie sich als Gegenüber im Diskurs ernst genommen fühlen. Seine Selbstdarstellung – seine Fernsehsendung hat garantiert keine negativen Auswirkungen (S. 19) – ist dabei ebenso peinlich wie die pauschale Verurteilung aller Medienpädagogen, „die von den Medien ja leben und sich aus genau diesem Grund nicht kritisch äußern“ (26).
Selbstverständlich sind auch andere Studien bisweilen fehlerhaft und nicht jede medienpädagogische Publikation darf unhinterfragt stehen bleiben. Dass aber „Ministerien, Kirchen, Wissenschaft, Amnesty International“ (S. 285) pauschal die Menschheit verdummen, wenn sie Spitzers Ergebnisse in Zweifel ziehen, grenzt an Verfolgungswahn („Wie es diesem Buch ergehen wird“, S. 283ff.) und Verschwörungstheorien (S. 293).
Was bleibt dann von diesem Pamphlet?
Im Kern ist ein Teil der Kritikpunkte von Spitzer bedenkenswert, aber die populistische und methodisch unsaubere Präsentation verstellt den Blick auf die philosophisch, soziologisch, politologisch sowie pädagogisch relevanten Fragen, die eigentlich zu diskutieren wären: Wie wollen wir künftig leben? Welchen Stellenwert haben digitale Medien in unserer Gesellschaft und wie kann deren absehbar weitere Verbreitung angemessen begleitet werden? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für Bildung in den unterschiedlichen Feldern und Lebensaltern? Wie sind insbesondere Kinder und Jugendliche angemessen an eine kompetente Nutzung digitaler Medien heranzuführen?
Oder ganz pragmatisch: Ist es sinnvoll und notwendig, Telefonnummern auswendig zu können – oder brauchen wir ganz andere Kompetenzen und Strategien des Wissensmanagements? Lauter relevante Fragen, die von Spitzer leider nicht beantwortet werden. Dafür liefert er im Fazit (S. 322-326) hilfreiche Tipps wie „Ernähren Sie sich gesund!“ (S. 323) oder „Singen Sie, denn das ist sehr gesund!“ (S. 324).
Ob übrigens der Illustrator des Buchumschlags, bei dem Spitzer sich abschließend überschwänglich bedankt, diesen völlig ohne digitale Medien erstellt hat, ist nicht überliefert. Dass dieses Buch aber auch als Ebook erhältlich ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Spitzer, Manfred (2012): Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. München: Droemer.
Weiterführende Informationen:
- Zur Studie „Jugend – Information – Multimedia“ des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest: http://www.mpfs.de/index.php?id=276
- Zur Sendereihe „Geist und Gehirn“ auf Bayern Alpha: http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/geist-und-gehirn/geist-und-gehirn102.html
- Grunert, Cathleen (2012): Bildung und Kompetenz. Theoretische und empirische Perspektiven auf außerschulische Handlungsfelder. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss (Studien zur Schul- und Bildungsforschung, 44).
Prof. Andreas Büsch
Professor für Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft an der Katholischen Hochschule Mainz
Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz