
© BR RESPEKT
Worum geht`s?
Eckdaten des Films:
Ein Film der Filmreihe RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!
Länge: 14 Minuten
Erscheinungsjahr, Produktionsland: 2018, Deutschland
Produktion: ARD Alpha / Bayrischer Rundfunk
empfohlen ab 12 Jahren
Schuljahre: ab Klasse
Spätestens mit dem Feldzug des US-Präsidenten Donald Trump gegen die freie Presse in den USA wird der Ton für Journalisten rauer. Sogenannte „Alternative Fakten“, Fake-News, der aufkommende Rechtspopulismus und Hetz-Kampagnen in Sozialen Netzwerken sind neue Herausforderungen. Welche Gefahr davon ausgeht und wie damit umzugehen ist, beschreibt die Reportage „Medien – warum die 4. Gewalt für die Demokratie so wichtig ist“. (© Bayrischer Rundfunk)
Welche medienpädagogischen Themen werden im Film angesprochen?
- Medienwirkung
- Medienkritik
- Fake News
- Kritische Medienarbeit
- Berichterstattung
- Pressefreiheit
- Medienkompetenz
Medien als wichtige gesellschaftliche Komponente
Medien spielen in jeder Gesellschaft eine wichtige Rolle. Sie stellen eine zentrale Schnittstelle zwischen der Bevölkerung, politischen Akteur:innen und der Welt dar. In einer demokratischen Gesellschaft kommen den Medien diverse Aufgaben zu. Die bekanntesten sind die Unterhaltung und Information der Öffentlichkeit. Zu diesen Funktionen kommen weitere hinzu, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz besitzen. Medien sollen nicht nur Neuigkeiten zur Verfügung stellen, sondern eine Einordnung der aktuellen Geschehnisse leisten und Rezipient:innen wichtige Hintergrundinformationen geben. Durch ein breites Spektrum von Informationsquellen schafft die Medienlandschaft eine Vielfalt, welche es den Menschen ermöglicht, kritisch auf Nachrichten zu blicken und diese einzuordnen. Dadurch wirken die Medien an der Befähigung der Bevölkerung mit, dem politischen und gesellschaftlichen Diskurs zu folgen, was wiederum eine fundierte Meinungsbildung ermöglicht.
Zudem lassen die Medien Menschen zu Wort kommen, die ohne sie keine große Reichweite hätten. Damit ermöglichen sie Teilhabe und politische Willensbildung. So kommt es zu einem Austausch zwischen Bürger:innen und Politik und es entstehen Vernetzungen innerhalb der Gesellschaft.
Schließlich ist die Kontrolle eine zentrale Funktion der Medien. Denn eine der Aufgaben der Medien ist es, die Handlungen und Pläne von Politik und Machthaber:innen der Gesellschaft transparent zu machen und kritisch zu hinterfragen. Meinungsfreiheit und die Freiheit zur Kritik an Menschen und Institutionen, die durch politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Positionen Macht besitzen, müssen in einer demokratischen Gesellschaft gewährleistet sein, um den Missbrauch von Macht aufzudecken und zu verhindern. Insofern sind Kritik und Kontrolle durch Medien eine wichtige Grundlage der Demokratie und ein Grundpfeiler unseres Rechtstaates.
Unabhängige Medien als Grundlage der Demokratie
Nachdem in der deutschen Geschichte vor allem das nationalsozialistische Regime eine freie Berichterstattung verhindert hatte und die Machthaber:innen Massenmedien wie das Radio nutzten, um Propaganda und Manipulation zu betreiben, hebt die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland den Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit besonders hervor (Art. 5 GG). Die Geschichte hatte gelehrt, dass eine unabhängige Berichterstattung ohne Einschränkung und Zensur für die Demokratie unabdingbar ist. Aufgrund ihrer Kontrollfunktion werden die Medien als 4. Gewalt bezeichnet. Denn neben der Judikative, der Exekutive und der Legislative sind sie im Hinblick auf die Gewaltenteilung ein bedeutender Grundpfeiler unseres Rechtsstaates. Zentral ist dabei ihre Unabhängigkeit von Parteien, Politik oder anderen Akteur:innen.
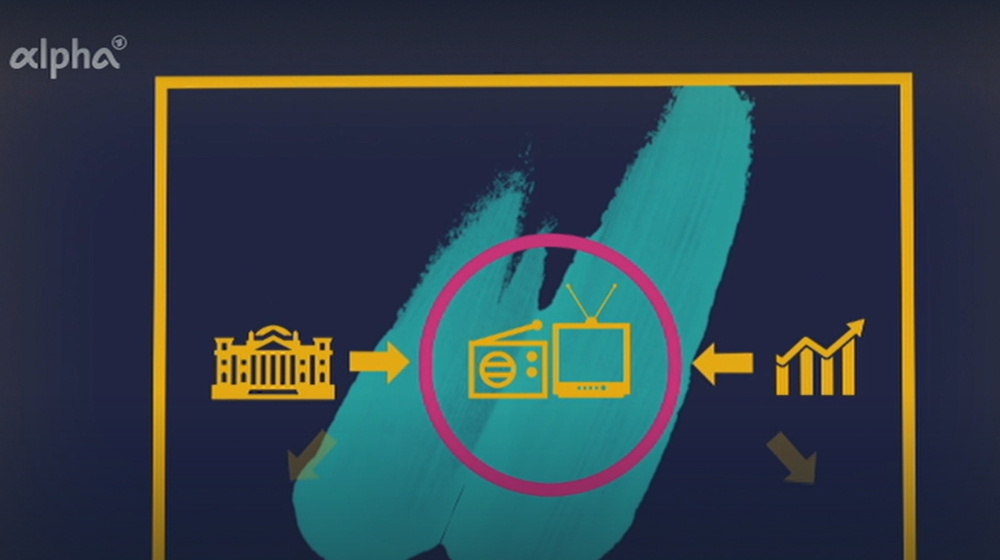
Freie Finanzierung ohne Einflussnahme
Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist die Berichterstattung sowie die Bildung, Beratung und Unterhaltung der Bevölkerung. Dazu muss eine unabhängige Finanzierung gesichert sein. Diese finanzielle Unabhängigkeit wird u. a. durch den Rundfunkbeitrag gewährleistet, der von den Bürger:innen entrichtet wird. Ein Kontrollorgan der öffentlich-rechtlichen Medien ist der Rundfunkrat. Er besteht aus Personen aus diversen gesellschaftlichen Bereichen, die gemeinsam mit unabhängigen Expert:innen darüber entscheiden sollen, in welche Projekte die Mittel fließen.
Das Konstrukt der öffentlich-rechtlichen Medien kann eine Einflussnahme nicht gänzlich ausschließen. Dennoch kommt es durch dieses komplexe System zu deutlich weniger Einflussnahme und Zensur als bei einem Staatsfunk.
Anders verhält es sich bei privat finanzierten Sendern und Medien. Die privaten Rundfunkanbieter zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Finanzierung durch andere Mittel und Methoden wie beispielsweise Werbeschaltungen, Produktplatzierungen und Abonnements gesichert wird. Sie können damit frei entscheiden, welche Projekte und Programme sie durchführen und anbieten. Gleichzeitig sind sie unmittelbar abhängig von den Geldgeber:innen, die direkt auf ihr Programm Einfluss nehmen und damit eigene Interessen durchsetzen können. Mittelbar sind sie zudem auf entsprechende Zuschauerquoten zur Rechtfertigung ihrer Werbepreise angewiesen.
Zur Medienkompetenz gehört der Aspekt des Medienwissens und damit auch das Verständnis für Strukturen und Zusammenhänge unser Mediensystem. Dieses „Struktur- und Orientierungswissen“ (Schorb) ist die Grundlage für die kritische Kompetenz (Medienkritik), die Bürger:innen einen kompetenten und selbstbestimmten Umgang mit Medien und Informationen ermöglicht. Es ist daher wichtig, Medienbildung für alle Bürger:innen zu ermöglichen und mit politischer Bildung zu verknüpfen – dies vor allem, da Politik und Parteiarbeit gerade in den letzten Jahren vermehrt in den Sozialen Medien stattfinden und diese neben den klassischen Medien für viele eine wichtige Informationsquelle sind.
Zum Einsatz in der (außer-)schulischen Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen
Medien sind im Alltag stets präsent. Seien es Zeitungen, das Autoradio, der Fernseher im Wohnzimmer, der Laptop oder das Smartphone. Von jedem dieser Geräte sind rund um die Uhr Informationen zugänglich, und es werden ständig neue Beiträge geteilt. Diese Fülle an Informationen besonders im Internet ist kaum kontrollierbar. Verbotene, fragwürdige oder falsche Inhalte können sich – nicht zuletzt aufgrund entsprechender Haltung der Plattform-Betreiber – nahezu ungehindert verbreiten.
Auch Kinder und Jugendliche sind von dieser Informationsflut betroffen. Umso wichtiger ist es, die Herausforderungen der digitalen Medien mit ihnen zu thematisieren. Eine wichtige Grundlage für die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Problemfeldern ist ein Verständnis für das System der Medien und der Berichterstattung in Deutschland. Die Entstehung und Entwicklung der Massenmedien und ihre kritische Vergangenheit in den Zeiten eines totalitären Regimes sollen mit Kindern und Jugendlichen thematisiert und reflektiert werden. Gleichzeitig bieten seriöse Medien ein notwendiges Gegengewicht zur tendenziell unkontrollieren Information aus Social Media-Kanälen. So können Kinder und Jugendliche durch das Verständnis der Geschichte und den Bezug zu aktuellen medialen Ereignissen eine fundierte und kritische Medienkompetenz erwerben.
Medienbildung und Medienkompetenz als Voraussetzung
Das Aneignen von Medienbildung und Medienkompetenz vom Kindesalter an ist in einer modernen Gesellschaft von zentraler Bedeutung, insbesondere angesichts der komplexen weltpolitischen Geschehnisse. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, Informationen und Berichte kritisch zu hinterfragen und zu bewerten. Dazu gehört es auch, einordnen zu können, welche Quellen verlässlich und seriös sind und welche nicht. Auch das Erkennen von Propaganda oder Fake News zählt zu diesen Kompetenzen. Es ist für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich, nachfolgende Generationen dazu zu befähigen, sich in der Fülle von Informationen zurechtzufinden und gezielt hilfreiche und wahre Berichte und Fakten erkennen und herausfiltern zu können. Denn nur so wachsen die Kinder zu mündigen Büerger:innen heran, die sich kompetent an demokratischen Prozessen beteiligen können.
Ein weiteres Themenfeld des Films ist die Beeinflussung durch Influencer:innen, besonders auf der Plattform Youtube. Die selben Muster können aber auch auf weitere Social Media-Plattformen wie TikTok und Instagram übertragen werden. Gerade diese Plattformen sind Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Sie verbringen viel Zeit auf den Plattformen und knüpfen teilweise parasoziale Beziehungen mit Creator:innen. Das nutzen diese, um durch bewusst gesetzte Kaufempfehlungen oder Produktplatzierungen Geld mit ihren Beiträgen zu verdienen. Kinder und Jugendliche sollen lernen, kritisch zu hinterfragen, was die Beweggründe der Influencer:innen sind und wie ihr Content einzuschätzen ist.
Zum Einsatz mit Erwachsenen und Senior:innen
Genauso wie Kinder sind auch Erwachsene und Senior:innen im Alltag nahezu ständig mit Medien und den darin geteilten Beiträgen konfrontiert. Im Laufe ihres Lebens hat sich die Medienwelt durch die Digitalisierung sehr gewandelt. Aus diesem Grund ist es auch für Erwachsene relevant, sich mit der Medienwelt zu beschäftigen und ihre Medienkompetenz zu schärfen und an neue Umstände anzupassen.
Auch Erwachsene und Senior:innen mit langer Medienerfahrung und gefestigter Persönlichkeit sind nicht davor gefeit, auf Fake News, Verschwörungen oder Propaganda hereinzufallen. Im Laufe eines Lebens kann es immer wieder zu Phasen und Umbrüchen kommen, die Menschen auch anfällig für derartige Praktiken machen können. Deshalb ist es für Erwachsene wichtig, aufmerksam zu sein und sich aktiv mit der Medienwelt auseinanderzusetzen. Zudem stehen Erwachsene, hier besonders Erziehungsberechtigte, in der Verantwortung, die künftige Generation auf ihre Rolle in der demokratischen und medialen Gesellschaft vorzubereiten. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, müssen Erwachsene über aktuelle mediale Phänomene informiert bleiben und sich mit den aktuellen Chancen und Risiken beschäftigen.

Anknüpfungspunkte für aktive Medienarbeit
Auf den Spuren der Mediengeschichte
Die Teilnehmer:innen arbeiten in Kleingruppen zusammen. Die Gruppen werden einem Medium wie Radio, Zeitung, Fernsehen oder soziale Medien zugeteilt. Die Teilnehmer:innen recherchieren zu den Anfängen und der Entwicklung ihres Mediums. Wenn es der Zeitrahmen erlaubt, können alte Versionen, gerade der Printmedien, in Bibliotheken ausgeliehen oder aus dem privaten Besitz mitgebracht werden. Als Abschluss erstellen die Teilnehmer:innen eine Präsentation zu der Entwicklung, z. B. in Popplet, und zeigen in dieser die Veränderungen und Unterschiede bei klassischen Medien im Laufe der Geschichte sowie zwischen traditionellen Massenmedien und Sozialen Medien auf.
Debatte zu Medien und Demokratie
Unter den Teilnehmer:innen soll eine Debatte über das Zusammenspiel von Medien und Demokratie angeregt werden. Ausgangspunkt dafür können verschiedene Fragestellungen sein, z. B. „Sollten die Sozialen Medien stärker kontrolliert werden?“ oder „Sind die Sozialen Medien förderlich oder hinderlich für die demokratische Gesellschaft?“. Die Teilnehmenden werden dafür in jeweils eine Pro- und eine Contra-Gruppe eingeteilt.Sie recherchieren online und reflektieren gemeinsam Perspektiven und Argumente. Dabei übernimmt ein:e Teilnehmer:in oder die Leiterin die Rolle der Moderator:in. Die Argumente können anschließend digital gesammelt werden, beispielsweise auf Taskcards.
Meinung oder Fakt
Die Teilnehmer:innen schauen sich in Kleingruppen eine Auswahl an Social Media-Beiträgen zu einem aktuellen Thema an. Ihre Aufgabe ist es, die Beiträge zu analysieren und zu unterscheiden, welche Aussagen auf Fakten basieren und welche Aussagen Meinungen oder persönliche Ansichten darstellen. Dabei sollen sie konkrete Hinweise in den Beiträgen, wie Quellenangaben, Sprache und Formulierung, identifizieren, die auf Fakten oder Meinungen hindeuten und diese schriftlich festhalten. Anschließend präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse, z. B. in Classroomscreen, und es wird im Plenum diskutiert, warum es wichtig ist, zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden.
Weiterführende Materialien
Weitere Materialien zum Thema Medien finden sich auf mekomat.de, beispielsweise Bedeutung von TikTok und Instagram als Informationsmedien für junge Menschen oder Das große Medienspiel. Zudem gibt es weitere Filmtipps, wie Aufwachsen in der Medienwelt oder Willi macht Schule: Kommunikation, die sich mit der Welt der Medien und den in ihr benötigten Kompetenzen beschäftigen.
Für wen?
Jugendliche ab 12 Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Senior:innen
Bezugsmöglichkeiten
Die Dokumentation ist als Online-Link über die Medienzentralen und in der ARD-Mediathek verfügbar.
Fazit
Die Reportage „Medien – warum die 4. Gewalt für die Demokratie so wichtig ist“ bietet einen Kurzüberblick über die Entstehung und die Aufgaben von Medien. Die geschichtliche Einordnung und die darauf begründete Relevanz der Medien für die Demokratie werden gut erklärt. Die Dokumentation bietet einen strukturierten Überblick über die Geschehnisse und die Gefahren, welche hinter der Zensur und der Beschneidung der Pressefreiheit stehen. Dabei kommen Menschen mit verschiedenen Perspektiven und Rollen in der Medienwelt zu Wort. „Medien – warum die 4. Gewalt für die Demokratie so wichtig ist“ schafft damit einen guten Einstieg in die komplexe Welt der Medien und spricht grundlegend relevante Themengebiete an. Für ein tieferes Verständnis empfiehlt sich eine weitergehende und facettenreichere Auseinandersetzung im Anschluss.
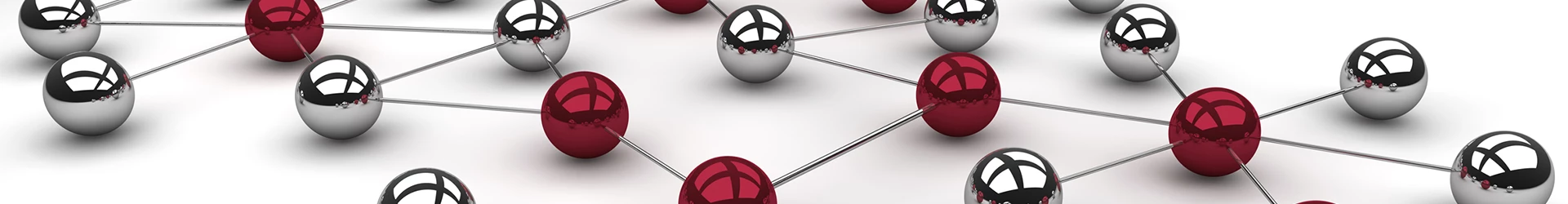


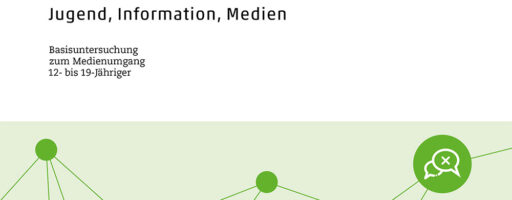

Pingback: Woran wir gerade arbeiten - Juni 2025 | Clearingstelle Medienkompetenz